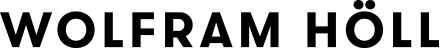Zunächst geht es hoch unters Dach des Schauspielhauses. Hier ist, in den Räumen einer ehemaligen Diskothek, eine neue Spielstätte (und Probebühne) entstanden. Ein kleiner, enger Raum, in den Andreas Auerbach quer einen Kasten gestellt hat, ein Hausgerippe, eine Plattenbauwohnung ohne Platten und Fensterscheiben. Darüber zwei Leinwände, von denen schon beim Einlass ein Mann spricht, “ein Vater, zwei Kinder, drei Verlierlinge, eine Mauer, die keine mehr ist”. Das wiederholt sich als Klangschleife und gibt damit Ton und Thema des kurzen Abends vor: Eine Familie, die zerbrochen ist, der die Mutter fehlt; eine Familie, der die Welt kaputt gegangen ist, in der nur noch die gewohnte Wohnung im Plattenbau so ist, wie sie immer war – doch auch hier gehen seltsame Dinge vor sich. (aus der nachtkritik-Kritik)
Besetzung
Regie: Claudia Bauer
Bühne & Kostüme: Andreas Auerbach
Musik: Peer Baierlein
Dramaturgie: Esther Holland-Merten, Matthias Huber
Mit: Wenzel Banneyer, Daniela Keckeis, Heiner Kock, Markus Lerch
Bilder oben: © Rolf Arnold
Premiere
04. Oktober 2013
Theater
Schauspiel Leipzig
Deutschlandradio, Michael Laages
Das schmerzhafte Erinnern wird so zum furiosen, intelligenten Spiel mit fast vergessener Wirklichkeit. Claudia Bauers Uraufführung von Wolfram Hölls jüngstem Text “Und dann …”, ausgezeichnet im Vorjahr auf dem “Stückemarkt” beim “Theatertreffen” in Berlin, hat die Erwartungen erfüllen können. Erinnerungen an die DDR Einmal mehr beschwört Höll die verschwindenden Erinnerungen an die Endzeit der DDR – aus der Sicht eines Kindes, dem nicht nur die Gewissheiten gesellschaftlicher Ordnung abhanden kamen, sondern das zuvor offenbar auch schon die Mutter verlor; wodurch auch immer, Scheidung, Ausreise oder Tod. Der Vater, vermutlich im Leipziger Uni-Betrieb an höherer Stelle beschäftigt und technisch höchst versiert als Radio-Bastler und Hobbyfilmer, kreiert im schönsten Moment des Textes eine sehr spezielle Erinnerung an Mama: als er auf dem Plattenbau gegenüber per Film-Projektor Mutter wieder auferstehen lässt, sie zurück holt ins Leben der Kinder. Der Text ist nicht auffällig theatralisch, eher rätselhaft in Poesie und Erzählung – Regisseurin Bauer und Ausstatter Andreas Auerbach kontern ihn mit Kinder- und Puppenspiel, Ganzkopfmasken, ausgestopften Bäuchen und riesigen Micky-Maus-Händen; sogar Pittiplatsch und seine Freunde, aus dem Paläozoikum des DDR-Kinderfernsehens, sind mit dabei. Das schmerzhafte Erinnern wird so zum furiosen, intelligenten Spiel mit fast vergessener Wirklichkeit. (04.10.2013)
Freie Presse, Torben Ibs
Eine psychologische Erkundung der anderen Art liefert “Und dann” in der Regie von Claudia Bauer […][…] Eine psychologische Erkundung der anderen Art liefert “Und dann” in der Regie von Claudia Bauer in der neuen Spielstätte Discothek. “Und dann” ist ein Text über einen alleinerziehenden Vater und seine beiden Kinder irgendwo in einem ostdeutschen Plattenbau. Die Mutter fehlt. Das Stück ist mehr Komposition denn Drama, weshalb der Text auch mit dem Hörspielpreis des Stückemarktes des Berliner Theatertreffen ausgezeichnet wurde. Regisseurin Claudia Bauer nutzt ihn als Folie für eine wilde, aber sehr genau komponierte Bühnen-Comic-Show. Die Schauspieler agieren mit riesigen runden Köpfen irgendwo zwischen Lego und Pinocchio auf einer Bühne, die das Gerippe einer Plattenbauwohnung darstellt – inklusive Balkon und Durchreiche (Bühne: Andreas Auerbach). Diese Köpfe, die auf grotesk ausgestopften Körpern sitzen, wirken grob, abwegig und herausfordernd. Doch hinter dem scheinbar Groben taucht eine feine Struktur in Sprache und Spiel auf. So entspinnt sich ein wirklich zauberhafter Abend, der dem, was als 3. Generation Ost durch die Diskussionen schwirrt, eine theatrale Form gibt, sich aber nicht von Tagespolitik vereinnahmen […] (06.10.2013)
Freitag, Janine Fleischer
Die Bühne skizziert eine Plattenbauwohnung als Puppenstube. Darin wirken Vater und Kinder mit ihren riesigen Pappmaché-Köpfen so monströs wie das, wovon Höll, 1986 in Leipzig geboren, erzählt […] Theater in der Diskothek Für zeitgenössische Texte und Uraufführungen gibt es jetzt die Diskothek in der ehemaligen Probebühne […] Wesentlich dramatischer gelingt Und dann. Wolfram Hölls Text ist ein atemloses Erinnern in Schleifen und Wiederholungen und chorischer Überlagerung, der Autor Hörspielpreisgewinner beim Berliner Theatertreffen, ausgezeichnet auf dem Heidelberger Stückemarkt und mit dem Literaturpreis des Kantons Bern. Die Zuschauer empfängt ein Mantra: “Ein Vater/zwei Kinder/drei Verlierlinge/eine Mauer, die keine mehr ist/ein Funkgerät/ein Projektor/ein alter Super-8-Film/ein neuer, der in den alten geschnitten wird/und dann.” Schon wie Wenzel Banneyer in einer Videoprojektion dieses “und dann” spricht – mit Trauer, Erwartung, auch Angst -, brennt sich ein. Regisseurin Claudia Bauer nimmt den Rhythmus des Textes auf, verteilt den Monolog des Kindes aber auf vier Schauspieler und verstärkt ihn so. Die Bühne skizziert eine Plattenbauwohnung als Puppenstube. Darin wirken Vater und Kinder mit ihren riesigen Pappmaché-Köpfen so monströs wie das, wovon Höll, 1986 in Leipzig geboren, erzählt: Von den Irritationen in einer sich auflösenden Welt nach dem Mauerfall, gespiegelt in der Abwesenheit der Mutter. Das Bild wird abends vom Vater auf Häuserfassaden projiziert. Hier war zu spüren, was oft nur zu sehen war: Liebe und Wut. Verzweiflung und Zerrissenheit. Davon kann es in Leipzig gern mehr geben. (10.10.2013)
Leipziger Volkszeitung, Peter Korfmacher
Da werden die Bilder der Kindheit zur Obsession, durchdringen sich Alltägliches und Katastrophe, wird Kochen zum bedrohlichen Gemetzel. Zweite Uraufführung: Wolfram Hölls verstörendes „Und dann“ Nein, Dramatik ist das nicht, Wolfram Hölls (Jahrgang 1986, geboren in Leipzig) „Und dann“. Beim Stückemarkt des Theatertreffens 2012 bekam er dafür den Hörspielpreis. Und in der akustischen Kunst, ist sie gut aufgehoben, diese verstörende Lyrik, die, während sie neu und neu Anlauf nimmt, einen fernen Verlust zu fassen, die Grenzen zur Musik streift. Aber Claudia Bauer gelingt es, unter diesem grandiosen Text eine dramatische Ebene einzuziehen, die ihn nicht nur bebildert oder in Aktionismus auflöst, sondern ihn albtraumhaft räsonieren lässt. Da werden die Bilder der Kindheit zur Obsession, durchdringen sich Alltägliches und Katastrophe, wird Kochen zum bedrohlichen Gemetzel und der Gottesdienst, den der Vater allabendlich zelebriert, indem er den Film der Mutter auf die Fassade des gegenüberliegenden Plattenbaus projiziert, damit sie wenigstens für die Kinder noch da ist, zum Menetekel der Unwiederbringlichkeit. Bauer zeigt eine dämonische Kinderwelt, in der sich Wahrnehmung und Vorstellung durchdringen und wechselseitig verformen. Wenzel Banneyer träumt, fiebert sich bereits vor Vorstellungsbeginn hinein. Im Bett liegt er, schweißgebadet, via Videoprojektion hoch über die Sperrholzwände erhoben, die eine Wohnungswelt begrenzen, in der nichts heil ist: „Ein Vater, zwei Kinder, drei Verlierlinge, vier Plattenbauten, eine Mauer, die keine mehr ist, ein alter Super-Acht-Film, ein neuer, der in den alten geschnitten wird – und dann …“ Bis zur Unerträglichkeit wiederholt Banneyer diese Aufzählung, immer gleich. Bis die Worte in Rhythmus aufgehen und Silben in Klang. Die Bilder, die ihm da durch den Kopf gehen, spiegelt Bauer in die Märchenwelt des Puppenspiels. Groteske Köpfe hat Andreas Auerbach ihr dafür gebaut, unter denen die enorm präsenten Schauspieler, neben Banneyer sind dies Daniela Keckeis, Heiner Kock und Markus Lerch, sich verbergen. Handschuhe mit vier Wurstfingern tragen sie, mit grob aus Pappe gebastelten Requisiten hantieren sie. Ein Spiel, an dem nichts harmlos ist und alles bedrohlich. So bedrohlich wie die überzeichneten Geräusche, so dräuend wie die Schleifen aus Wagners Parsifal, die so hoffnungslos auf der Stelle treten wie dieser Vergegenwärtigungs-Spuk, der kaum länger als eine Stunde dauert, aber sich bleiern aufs Gemüt legt. Großes Theater im kleinen Format. Ausführlicher Applaus. (07.10.2013)
nachtkritik, Ute Grundmann
Und auch die, die fehlt, erscheint nur als Projektion auf der Hauswand: Die Mutter. Sie bleibt ein Bild, bekommt keine Geschichte, keinen Hintergrund. […] Zunächst geht es hoch unters Dach des Schauspielhauses. Hier ist, in den Räumen einer ehemaligen Diskothek, eine neue Spielstätte (und Probebühne) entstanden. Ein kleiner, enger Raum, in den Andreas Auerbach quer einen Kasten gestellt hat, ein Hausgerippe, eine Plattenbauwohnung ohne Platten und Fensterscheiben. Darüber zwei Leinwände, von denen schon beim Einlass ein Mann spricht, “ein Vater, zwei Kinder, drei Verlierlinge, eine Mauer, die keine mehr ist”. Das wiederholt sich als Klangschleife und gibt damit Ton und Thema des kurzen Abends vor: Eine Familie, die zerbrochen ist, der die Mutter fehlt; eine Familie, der die Welt kaputt gegangen ist, in der nur noch die gewohnte Wohnung im Plattenbau so ist, wie sie immer war – doch auch hier gehen seltsame Dinge vor sich. “Und dann” nennt Wolfram Höll sein Stück, ein Titel, der das atemlose, stakkatohafte Erzählen eines Kindes aufnimmt. Das Stück gleicht einer mit der Schreibmaschine getippten Text-Partitur: eine schnelle, spannende Abfolge von Assoziationen, Ängsten, Erinnerungen und Erlebnissen in der Nach-Wende-Zeit. Claudia Bauer nimmt in ihrer Uraufführungs-Inszenierung diesen Rhythmus auf, setzt aber keine reale Szenerie dazu, sondern Verfremdung: In der Wohnung hausen Puppen, Schauspieler mit großen Puppenköpfen und Händen, mit Pinocchio-Nasen. Sie spielen so etwas wie Familie, decken den Tisch, essen Papierschlangensuppe zu Mittag, streiten sich, ob erst der Plattenbau oder erst die Verlierlinge da waren. Darüber immer das Filmbild des Mannes (Vaters?), der sich einen Gletscher wünscht, der alles fortreißt. Stimmen erinnern sich an Klingeln, auf die niemand antwortet, an die “Panzerparadenstraße”, die nun eine “Wagenparadenstraße” ist, auf der West-Autos fahren. Die Stimmen mischen, streiten, erinnern sich, die Figuren erscheinen mal als Puppen, mal im Film. Und auch die, die fehlt, erscheint nur als Projektion auf der Hauswand: Die Mutter. Sie bleibt ein Bild, bekommt keine Geschichte, keinen Hintergrund. Sie ist allein die Fehlende, dort, wo die Kinder-Puppen tapfer sagen, dass sie keine Angst haben, auch wenn sie ihre gewohnte Welt verloren haben. Am Ende ist dann auch der Text nur noch eine Projektion und die Aufführung wird ausgeknipst wie ein Filmprojektor. (04.10.2013)
reihesiebenmitte :: blog
Einzig Wolfram Hölls Und dann vermag sich in der Stadt und ihrer Geschichte zu verorten – eine atemlose Kindererzählung aus den Plattenbauten der Nachwendezeit Die Verlierlinge sind hier die Gewinnlinge Einzig Wolfram Hölls Und dann vermag sich in der Stadt und ihrer Geschichte zu verorten – eine atemlose Kindererzählung aus den Plattenbauten der Nachwendezeit um Verlust, Verlorenheit und die Leerstellen der Erinnerung. Claudia Bauers Inszenierung ist es denn auch, die aus dem konzeptionellen und ästhetischen Einheitsbrei des Eröffnungswochenendes wohltuend heraussticht – wie sie und ihre Darsteller diesen starken, assoziativen, rhytmischen Text aufnehmen, ihn anfüllen, befragen, mit ihm spielen – das ist absolut sehenswert. (06.10.2013)
Süddeutsche, Helmut Schödel
[…] ein pseudoavantgardistisches Gemurmel, dem man immerhin entnehmen kann, dass die Mutter des Autors nicht oft zu Hause war und ihn das Wiedervereinigungsdrama unbehütet antraf. Die beiden Uraufführungen waren dann ein einziger Redeschwall, Wortkaskaden, aber kein Satz dabei, den man sich hätte merken wollen […]. Und dann gab es “Und dann” des jungen, in Leipzig aufgewachsenen Autors Wolfram Höll, ein pseudoavantgardistisches Gemurmel, dem man immerhin entnehmen kann, dass die Mutter des Autors nicht oft zu Hause war und ihn das Wiedervereinigungsdrama unbehütet antraf. Regisseurin Claudia Bauer inszeniert dazu, begleitet von Peer Baierleins Musik, in einer unwirtlichen Wohnung einen grenzdebilen Eiertanz mit menschlichen Puppen. Alles im Grunde ein abgrundtiefes Missverständnis. Aber Lübbe weiss, dass er solche Irrwege eigentlich nicht mehr gehen darf, selbst auf die Gefahr hin, als Partyverderber zu gelten […] (07.10.2013)
taz, Torben Ibs
[…] mehr Sprachkomposition denn Drama. Bauer übersetzt dies in eine ebenso künstliche wie anmutige Bühnensprache. Wesentlicher souveräner ist der Umgang von Claudia Bauer mit dem poetisch-verkapselten und mehrfach preisgekrönten Text „Und dann“. Der Autor Wolfram Höll beschreibt darin die Wendezeit mit fehlender Mutter im ostdeutschen Plattenbau aus Kindersicht – mehr Sprachkomposition denn Drama. Bauer übersetzt dies in eine ebenso künstliche wie anmutige Bühnensprache. Die Schauspieler tragen riesige runde Köpfe und sind grotesk ausgestopft. Die Bühne ist das Skelett einer Plattenbauwohnung, in der sich die immer gleichen Rituale des Alltags abspielen. Erinnerungen sind in kleinen Episoden versteckt, die erzählt werden. Spiel und Text kommentieren sich gegenseitig bei diesem menschlichen Puppentheater. Video und geloopte Sounds (Musik: Peer Baierlein) sorgen für weitere Erlebnisebenen. Ein Abend voller Theaterlust, der die Poleposition sichert. (08.10.2013)
Theater heute, Franz Wille
Am Ende weiß man alles über diesen kleinen Menschen, ohne dass man deshalb mehr über ihn erfahren hätte, als er von sich selber auch nicht weiß. War’s das? Noch nicht. Und dann gab es nämlich noch «Und dann» (der vollständige Stückabdruck liegt diesem Heft bei). Die Uraufführung von Wolfram Hölls Erinnerungsspur in den Kopf eines vielleicht sechs- bis achtjährigen Kindes, das Mitte der Neunziger in irgendeiner Plattenbausiedlung ohne Mutter mit seinem überforderten alleinerziehenden und vermutlich arbeitslosen Vater samt einem Geschwister gelebt haben muss. Solche Lebensrahmen-Details muss man sich im Text allerdings erst mühsam zusammensuchen oder erschließen, denn «Und dann» kennt nur eine Perspektive: die eines Jungen, der sich seine fremde, neu/alte Umgebung erklären will und die vielen Einzeleindrücke, aus denen sich kein rechtes Sinngebäude ergeben will, mit einem unablässigen «und dann» aneinander klebt. Eine wackelige, lückenhafte Welt aus langen, eintönigen Tagen, verblassenden Vorwende-Erinnerungsresten, täglichen Routinen und zuweilen rätselhaftem Vaterverhalten wird im Kinderkopf notdürftig zusammengeleimt. Da gibt es die seltsamen Findlinge vor dem sonst so rechteckigen Plattenbau; den Vater, der tagelang in seinem Zimmer verschwindet und an einem alten Funkgerät oder Filmprojektor bastelt; Ausflüge in die nahe Stadt mit einer großen Straße, auf der früher einmal im Jahr die Panzer fuhren und jetzt die neuen Autos, die schon alte Autos sind. Dazwischen blitzen Erinnerungen an die Mutter auf, die unerklärbarerweise nicht mehr da ist, an Schlafengehen- und Aufstehenmüssen. Einzelne Phrasen wiederholen sich und spalten sich auf in verschiedene Tonspuren eines inneren Monologs, in Erzählschübe und -Blockaden, in Ungeduld, Langeweile, Staunen und Nachdenken. Wolfram Höll, 1986 in Leipzig geboren, lebt in Biel bei Bern und hat am dortigen Literaturinstitut studiert. «Und dann» entstand während eines Stipendiums am Théâtre Vidy-Lausanne und hat schon ein paar kleinere Preise bekommen, darunter 2012 den Hörspielpreis des Theatertreffen-Stückemarkts. Ewald Palmetshofer schrieb in seiner Laudatio: «Fehlen, Vermissen, Verlust und Tod sind nur indirekt als Störung, Fehler oder Irritation anwesend abwesend.» Der Text umkreist geduldig einen Webfehler im eigenen Lebenssystem, der, weil er zum System gehört, ein blinder Fleck bleiben muss: die behütete Unsicherheit in einer Normalität, deren innere und äußere Maßstäbe diffus bleiben. Wer will, kann darin auch die Erfahrung jener mittlerweile dritten DDR-Generation wiederfinden, die die Wende nur ungenau als Kinder erlebt haben, aber umso genauer die Geworfenheiten, Existenz- und Entwertungsängste ihrer Eltern. Claudia Bauer holt das «Hörspiel» aufs Theater, genauer in die schon erwähnte Diskothek. Über Eck blickt man auf eine in den Raum gekantete Plattenwohnung mit ein paar ausgesuchten Wandlampen, Küchenmöbeln und Deko-Perlen aus dem späten Honeckertum. Aber der punktuelle Scheinrealismus täuscht. Rechts an der Wand wächst ein großes blinkendes Pappmonster mit einer wagenradgroßen Filmspule und vielen seltsamen Schaltern, an denen sich auch herrlich schnarrend drehen lässt. Der dritte Wirklichkeitssender ist ein eher profaner Videoscreen hoch über der Sitzecke, die Direktschalte ins Kinderzimmer. In mindestens drei Perspektiven fächern die Regisseurin und ihre vier Schauspieler – Wenzel Banneyer, Daniela Keckeis, Heiner Kock und Markus Lerch – den Erzählerbericht auf: mal als bedrängenden Monolog zwischen Staunen, Panik und spitzen Freudeausschlägen aus dem Video-Off, dann mit blechernen Stimmen aus riesenmelonengroßen Kindskopfmasken und grotesk wattierten Kostümen frei nach Burattino, der sowjetischen Pinocchio-Variante, die sich drei Mitspieler übergezogen haben. Diese ewig lächelnden, dumpfen Wiedergänger einer heilen Kinderwunschwelt, die längst zerbrochen ist, drängen mit unheimlichem Gleichmut in die Wohnung, um ebenso grundlos wieder zu verschwinden oder leise wippend aus der Küchennische zu grüßen. Dazwischen stumme Sequenzen bei Tisch in gruseliger Behaglichkeit, zu krachenden Essgeräuschen aus den Mündern, während Peer Baierleins Musik sich kalkuliert übersteuert in düster orchestrale Atmosphären loopt. Und immer wieder blinkt verführerisch drohend Vaters monströse Wundermechanik. Zwischen Angstschüben, Gruselkabinett und bescheidener Idylle mit einem kräftigen Schuss David Lynch verorten Claudia Bauer und ihr Team Hölls «Und dann» – nicht ohne kleine Verbeugung in Richtung Vinge/Müllers «Borkman» mit seinen monotonen Ritualen aus ungelüftet gewaltbereiten Kinderzimmern. Am Ende weiß man alles über diesen kleinen Menschen, ohne dass man deshalb mehr über ihn erfahren hätte, als er von sich selber auch nicht weiß. Da war es also doch noch, das ganz Andere. (12/2013)
Die Welt, Reinhard Wengierek
[…] ein kleines großes Wunderwerk an zart verspielter Fantasie. […] Zwischendurch jedoch entfaltete die Regisseurin Claudia Bauer mit Wolfram Hölls schwer melancholischem und zugleich naiv spukhaftem Trauertext über Kindheitsverluste “Und dann” ein kleines großes Wunderwerk an zart verspielter Fantasie. Allein das war’s! (07.10.2013)